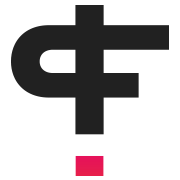Blog

Afterwork-Drinks & die Antwort auf die Frage: Gibt es dich wirklich?
Von Noreen Schneider
„Treffen wir uns noch auf einen Afterwork-Drink"…

Ich bin dann mal weg! Viel Meer statt 9 to 5…
Von Noreen Schneider
„Schönen Urlaub", „Ja danke, gleichfalls"…

Gütersloh im März
Alles hat seine Zeit – oder warum ich die CeBIT nicht vermisse.
Es…
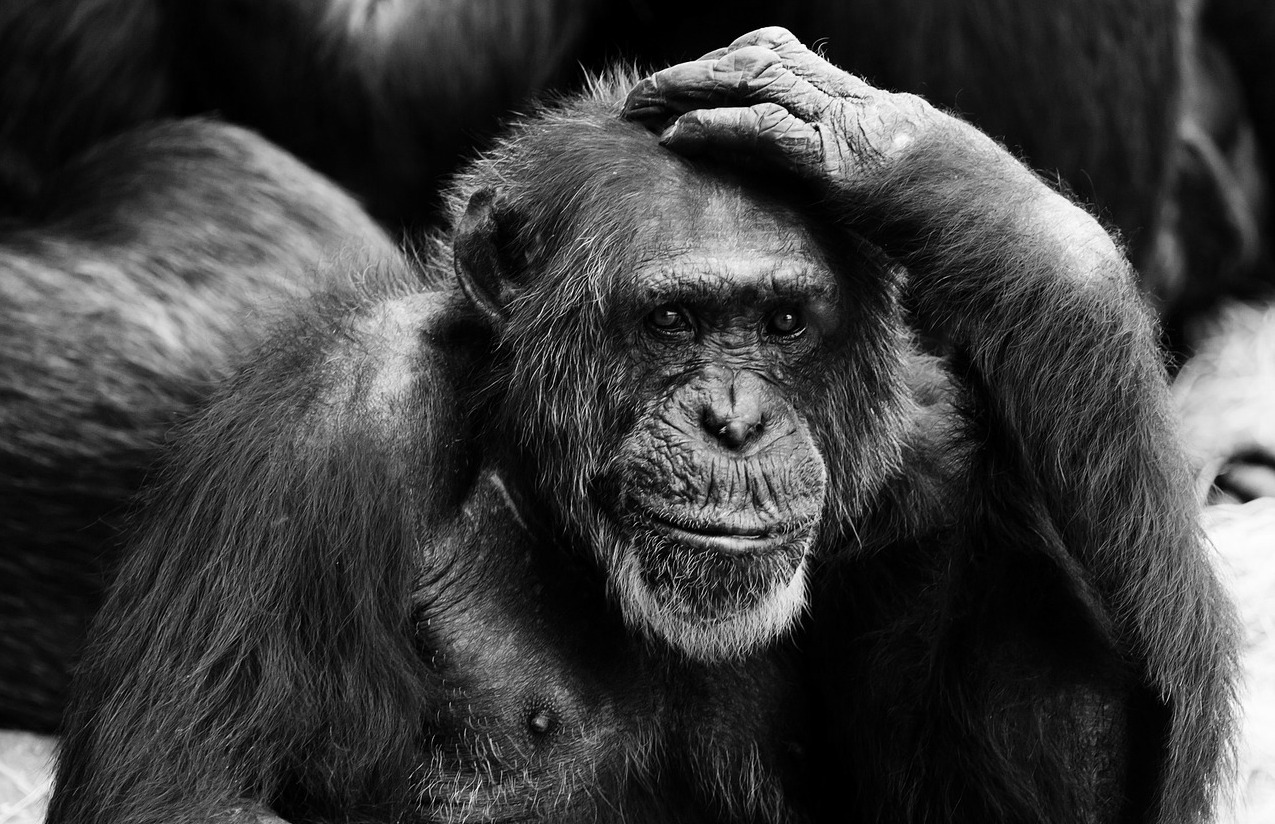
Mit agiler Ambidextrie zu ganzheitlicher Disruption
Die Headline hat Ihre Aufmerksamkeit gewonnen, aber Sie haben…

„Holmes: Schreib einen Blog”
Sie kaufen und verkaufen Aktien im Sekundentakt, empfehlen Produkte,…

Acht Tipps, wo die PR-Kamele hinlaufen
Egal, in welcher Branche man unterwegs ist – ob Mode, Musik,…

Neu in den B2B-Social-Media-Charts: Von Null auf 3!
In dieser Woche hat Brandwatch gemeinsam mit Somtypes den “B2B…

Schiff Ahoi!
Die Schifffahrt - immer noch ein sagenumwobenes Metier, das von…

Über den Wolken …
… muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. So startet der wohl…

„Shanghai calling”: Public Footprint erreicht Asien
Vom vernetzten Arbeiten haben wir bei Public Footprint immer…

Chatbots als Pressesprecher: Kollege Roboter übernimmt dann mal
Erinnern Sie sich noch an den Tankwart? Oder die Datatypistin?…

Neu an Bord: Avoka
Nah am Kunden – das wollen viele Banken gerne sein. Aber…

Down Under – Außenstelle Sydney eröffnet
Sydney ist nicht nur die größte Stadt in Australien,…

Was PR & Social Media mit Auto fahren gemeinsam haben
/
0 Kommentare
„Kuppeln, Sie sollen die Kupplung treten! Das gibt es doch nicht, jetzt ist die Kiste schon wieder abgesoffen.“ - Ich erinnere mich, als ob es gestern war: Meine erste Fahrstunde, damals in Wiesbaden. ...

Wollen Sie mal zuschlagen?
Social Media - das kann doch jeder; ist in 5 Minuten am Tag zu schaffen; das machen Sie doch locker neben dem Marketing mit; da brauchen wir/Sie kein Budget für. ...